Gender in der Lehre
Veranstaltungen
Rechtswissenschaft (Fachbereich 01)
[Si] Migración, Mujeres y Desigualdades Sociales
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr | k.A. | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: k.A. | ||
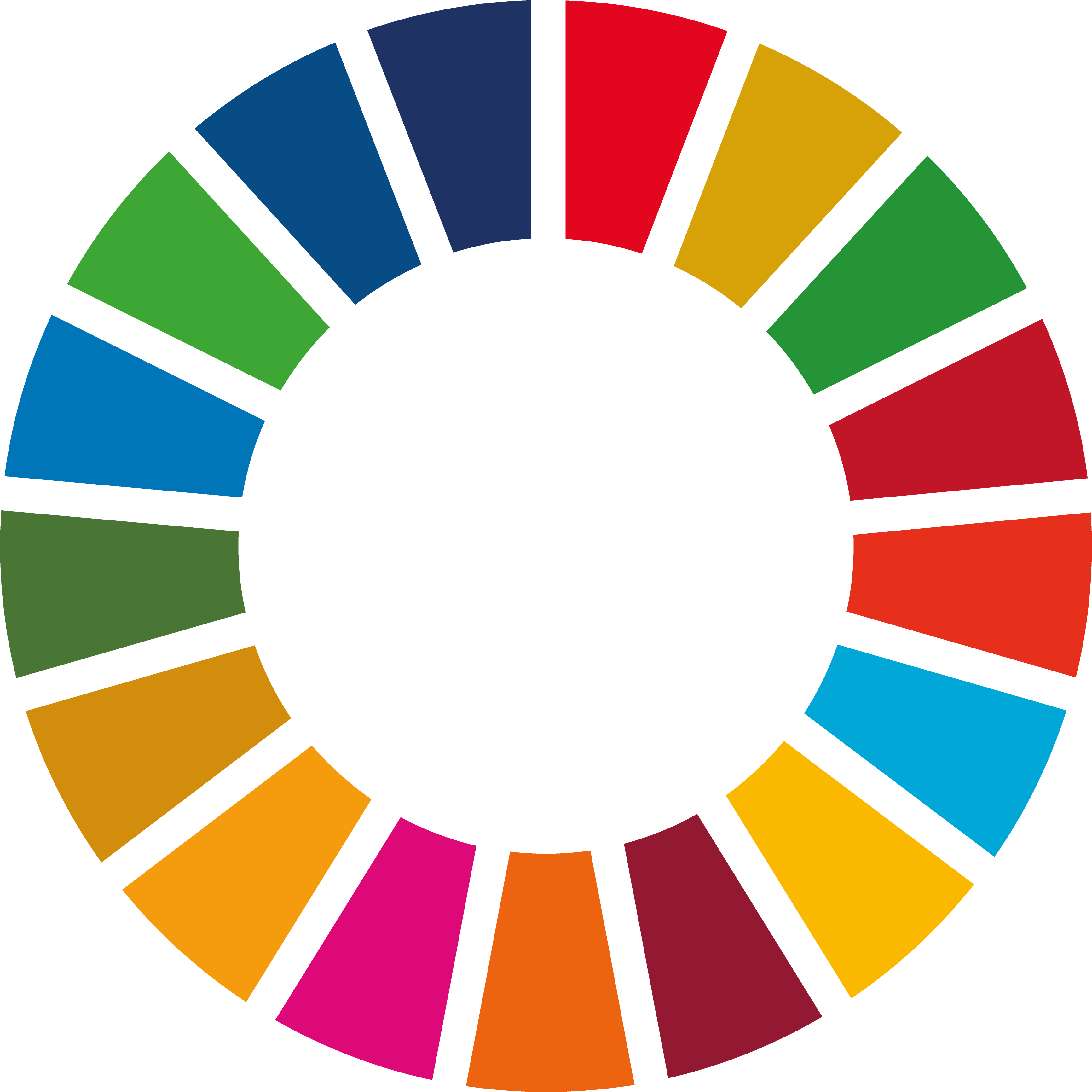
SDG 10 – Weniger Ungleichheiten
Teniendo como marco los Derechos Humanos de las mujeres el curso analiza la reproducción de las desigualdades sociales y de género a través de la interrelación entre las categorías mujer y migración. Se propone brindar a quienes participan en el curso contenidos que sirvan para el análisis teórico de las migraciones a partir de una visión crítica centrada en el enfoque de género feminista. En las últimas clases se profundizará el lugar de las memorias migrantes en la resignificación de identidades colectivas y en el tránsito del duelo migratorio. Este curso se abordará desde un enfoque interdisciplinario, el acercamiento a las temáticas principales del curso se realizará a través de lecturas desde diversos enfoques disciplinarios tales como la sociología, el derecho, la ciencia política, la psicología y la antropología. El curso apuesta por una pedagogía que integre las dimensiones culturales al espacio académico, particularmente los aportes del cine, la música y la literatura a la comprensión de las temáticas abordadas en el curso. La propuesta consiste en clases expositivas aunadas al trabajo autónomo semanal de lecturas obligatorias por parte del estudiantado y la participación de foros al final de clase.
[Si] Política Exterior Feminista en Europa y América Latina
El curso reflexiona de manera amplia sobre las relaciones internacionales desde una perspectiva de género y feminista, incluyendo tanto aspectos teóricos como experiencias prácticas. Se divide en cuatro módulos que desarrollan los siguientes temas: 1. Teorías feministas, género y relaciones internacionales, 2. Política Exterior Feminista (PEF): debates y reflexiones en Europa y América Latina, 3. Resolución 1325 de Naciones Unidas y agenda de Mujeres, paz y Seguridad, y 4. PEF y otras áreas de intervención.
Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 02)
[M] Gender und Diversity – Analyse und Gestaltung von Kulturwandel in Organisationen (02-Q:MSc-Dekanat-Extra1)
Nähere Informationen wie z.B. zum Kursablauf werden beim ersten Termin besprochen.
Die erfolgreiche Teilnahme (6 CP benotet) erfordert eine unbenotete Gruppenpräsentation und eine benotete Hausaufgabe. Das Thema für die Hausaufgabe kann aus der Präsentation hervorgehen oder in Absprache mit Fr. Kiotzenoglou ausgesucht werden.
BITTE BEACHTEN:
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt auf 19.
Die Anmeldung erfolgt ab dem 14.08.25 7:00 Uhr und endet am 7.10.25 23:59 Uhr.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch - Teilnehmende müssen mindestens B2 haben - und die Veranstaltung wird durchgehend von Fr. Luisa Kiotzenoglou unterrichtet.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 08:00 - 10:00 Uhr | Licher Straße 68, 024 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Licher Straße 68, 024 | ||
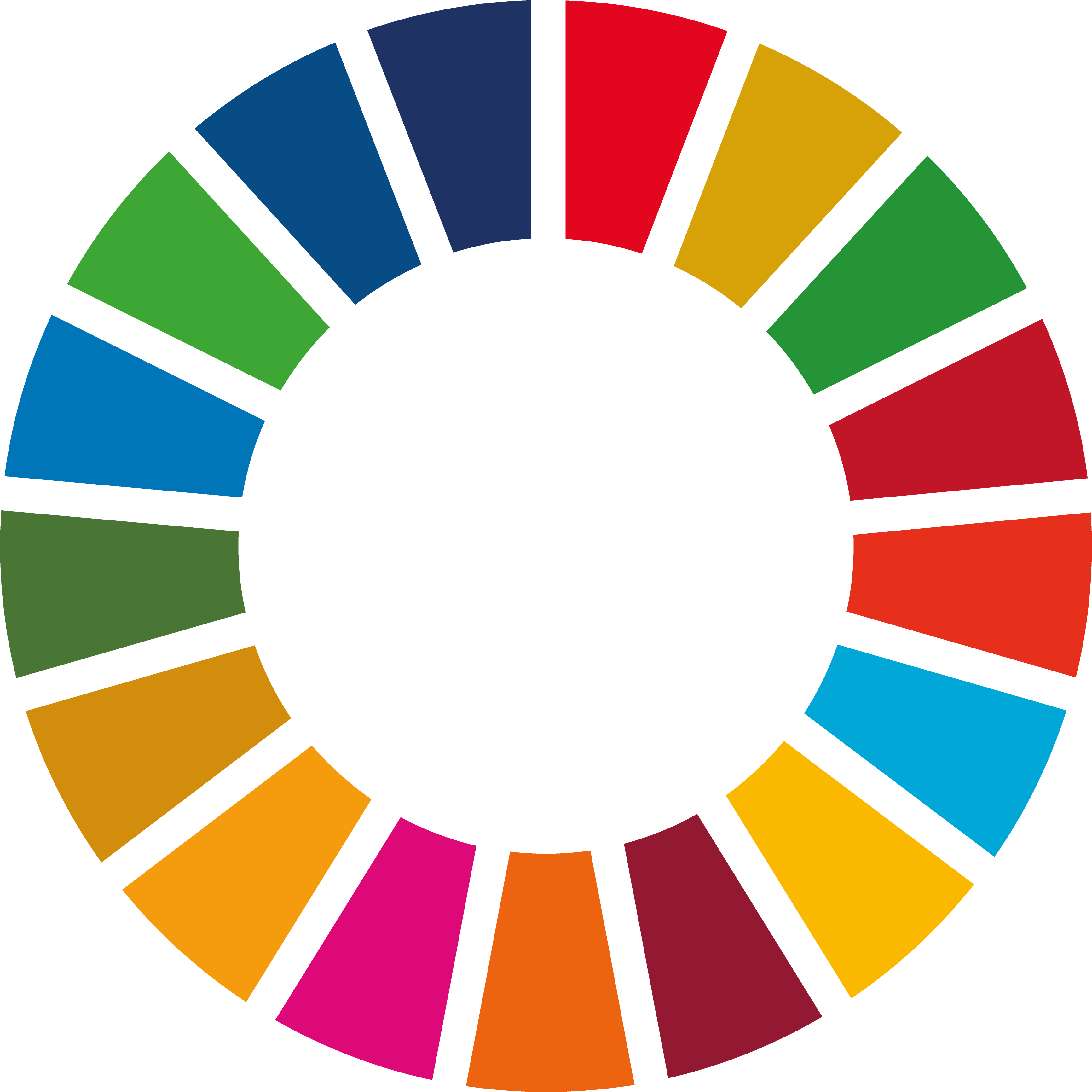
SDG 5.1 – Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen beenden
Ziel der Veranstaltung ist es Studienrenden nicht nur fundiertes Wissen um zentrale Gender- und Diversitäts-Aspekte im beruflichen Kontext zu vermitteln, sondern auch Gender- und Diversity-kompetente Handlungsweisen in Unternehmen aber auch in öffentlichen Einrichtungen aufzuzeigen und zu analysieren. Dabei sollen mit Hilfe des angeeigneten Wisses, langfristige Lösungsstrategien zum Überwinden typischer soziokultureller und sozioökonomischer Widerstände erarbeitet werden.
Inhaltlich werden z.b. Gender- und Diversitymanagement, Inklusion, Interkulturalität, Migration, Sorgearbeit, New Work, Digitalisierung, Gendernomics, Doing Gender und andere wichtige Themen und Aspekte, die einen Kulturwandel in Organisationen hervorrufen, vorgestellt und besprochen.
Die Inhalte werden mit interaktiven Lehrmethoden erarbeitet: Nach einem Impuls werden die Teilnehmer/-innen angeleitet, kontrovers zu diskutieren, Fallbeispiele zu erarbeiten und Gruppenaufgaben bzw. -projekte selbständig zu be- und auch erarbeiten.
Der Kurs wird dienstags von 8:30-10 Uhr stattfinden. Es herrscht Anwesenheitspflicht.
Nähere Informationen wie z.B. zum Kursablauf werden beim ersten Termin besprochen.
Die erfolgreiche Teilnahme (6 CP benotet) erfordert eine unbenotete Gruppenpräsentation und eine benotete Hausaufgabe. Das Thema für die Hausaufgabe kann aus der Präsentation hervorgehen oder in Absprache mit Fr. Kiotzenoglou ausgesucht werden.
BITTE BEACHTEN:
Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt auf 19.
Die Anmeldung erfolgt ab dem 14.08.25 7:00 Uhr und endet am 7.10.25 23:59 Uhr.
Die Unterrichtssprache ist Deutsch - Teilnehmende müssen mindestens B2 haben - und die Veranstaltung wird durchgehend von Fr. Luisa Kiotzenoglou unterrichtet.
Sozial- und Kulturwissenschaften (Fachbereich 03)
[Si] Clara Schumann, Fanny Hensel und ihre Zeitgenossinnen: Komponistinnen und Musikerinnen im 19. Jahrhundert
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2025 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr | Phil. II D, 07 | |
| nächster Termin: 12.02.2026 Uhr, Raum: Phil. II D, 07 | ||
1. Zum Thema: Ausgehend von zwei der bis heute bekanntesten Künstlerinnenpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts, Clara Schumann (1819–1896) und Fanny Hensel (1805–1847), widmet sich das Seminar Musikerinnen und Komponistinnen dieser Epoche – darunter auch solchen, die in der Musikgeschichte bislang kaum erforscht sind. In einer Mischung aus Biografieforschung, musikalischer Analyse und historischer Kontextualisierung von Leben und Schaffen werden neben Schumann und Hensel u. a. die Werke von Louise Farrenc (1804–1875), Emilie Mayer (1812–1883), Pauline Viardot-García (1821–1910), Ethel Smyth (1858–1944) und Amy Marcy Beach (1867–1944) eingehender untersucht. Gattungs-, kompositions- und rezeptionsgeschichtliche Themen werden im Rahmen des Seminars ebenso behandelt wie Gender-Fragen, sodass eine Musikgeschichte des (langen) 19. Jahrhunderts aus einer neuen Perspektive gezeichnet wird.
2. Literatur: STEEGMANN, Monica: Clara Schumann, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 52020; BÜCHTER-RÖMER, Ute: Fanny Mendelssohn-Hensel, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 2001.
3. Voraussetzungen für den Scheinerwerb: Teilnahmeschein bei regelmäßiger Teilnahme und aktiver Mitarbeit sowie Kurzreferat; Leistungsschein bei regelmäßiger Teilnahme und aktiver Mitarbeit sowie Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder Hausarbeit (die genauen Modalitäten werden in der ersten Sitzung gemeinsam besprochen)
4. Teilnahmevoraussetzungen und -beschränkungen: keine
[Si] FSL III.4 B Mobbing im Kontext der inklusiven Schule (FSL III.4 B)
[Si] FSL III.4 B Schüler:innen verstehen, sich selbst reflektieren: Motivation, Selbstbild, Fehlerkultur und Vielfalt im Fokus (FSL III.4 B)
| regelmäßiger Termin ab 22.10.2025 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr | Phil II, E 112 | |
| nächster Termin: 11.02.2026 Uhr, Raum: Phil II, E 112 | ||
[Si] FSL III.4 B Tiere in pädagogisch-therapeutischen Kontexten (FSL III.4 B)
| regelmäßiger Termin ab 22.10.2025 | ||
| wöchentlich Mi. 08:00 - 10:00 Uhr | Phil II, E 101 | |
| nächster Termin: 11.02.2026 Uhr, Raum: Phil II, E 101 | ||
[H Si] Musik im Kontext von Race und Gender
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr | Phil. II D, 08 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. II D, 08 | ||
Im Seminar erarbeiten wir uns einen Überblick über Theorien kultureller Hegemonie mit Fokus auf den Aspekten Gender und Race (Feminismus, Queerfeminismus, Critical Race Theory, Postkolonialismus). Die Lektüre und Diskussion von Grundlagentexten soll fruchtbare Perspektiven auf konkrete musikbezogene Fallbeispiele eröffnen. Fragen könnten beispielsweise sein: Welche Auswirkungen hatte das Frauenbild im 19. Jahrhundert auf den Musikdiskurs und umgekehrt? Wie wird Gender am Broadway performt? Welche Bedeutung haben Praktiken kultureller Aneignung für die Geschichte der Oper? Ist Musiktheorie strukturell weiß? Ist Hip-Hop antirassistisch?
Modulzuordnung neue Lehramtsstudiengänge:
03-mus-L3-WP-4b
Liberal Arts:
BA-LAS-PDK-5 (Institutionskritik)
BA-LAS-PDK-4 (Funktionen der Künste)
Geschichts- und Kulturwissenschaften (Fachbereich 04) ⇑
Altertumswissenschaften ⇑
Evangelische Theologie ⇑
[Si] (Be-)Deutungen von Geschlecht in der Bibel
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2025 | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr | Phil. II, H 205 | |
| nächster Termin: 11.02.2026 Uhr, Raum: Phil. II, H 205 | ||
Nur zu gerne wird mit der Bibel in der Hand noch immer Zweigeschlechtlichkeit, Geschlechterhierarchie und Homophobie begründet, aber wie berechtigt ist das? Im Seminar wird ein Bibelverständnis vermittelt, das sich von der Dominanz heteronormativer Perspektiven abgrenzt und die Diversität biblischer Texte und ihrer Auslegungen aufzeigt. Das macht deutlich, wie sehr Bibellektüren von den Perspektiven gesteuert werden, mit denen an die Texte herangetreten wird. Den Ausgangspunkt des Seminars bildet die aktuelle Geschlechterforschung. Das Seminar zielt darauf ab, zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Bibeltexten und ihren Auslegungen zu befähigen und fundierte eigene kreative theologische Positionierungen (auch) zu Geschlechterfragen zu ermöglichen.
Literatur:
Forderer, Tanja/Gerber, Christine/Kaiser, Ulrike/Petersen, Silke (Hg.): In aller Vielfalt. Geschlechter, Sexualitäten, Beziehungsformen im Neuen Testament und seinen Kontexten, Tübingen 2025.
Scholz, Susanne (Hg.): Doing Biblical Masculinity Studies as Feminist Biblical Studies? Critical Interrogations, Sheffield 2023.
Schubert, Anselm: Christus (m/w/d). Eine Geschlechtergeschichte, München 2024.
Siquans, Agnethe/Eder, Sigrid (Hg.): Ist die Bibel frauenfeindlich? Biblische Frauenbilder und was wirklich dahintersteckt, Stuttgart 2025.
Smit, Peter-Ben/
Pasterkamp, Laura (Hg.): Masculinities in the New Testament and Beyond, Amsterdam 2025.
Stone, Ken: LGBTI/Queer Interpretation, in: Boxall, Ian/Gregory, Bradley C. (Hg.), Companion to Biblical Interpretation, Cambridge 2022, 246-264.
Fachjournalistik Geschichte ⇑
[P Si] Amateurfilme: Vom Archiv auf die Leinwand
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2025 | ||
| wöchentlich Mi. 10:00 - 12:00 Uhr | Phil. I, C 011 | |
| nächster Termin: 11.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 011 | ||
Amateurfilme, produziert für den privaten oder halb-öffentlichen Gebrauch, zählen zu den beliebtesten Visualisierungsformen in Geschichtsdokus und Dokumentarfilmen. Oftmals werden diese historischen Aufnahmen zur Illustration eingesetzt, um Geschichten zu bebildern, mit denen sie in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen. Nur selten befragen Dokumacher:innen die Bilder nach ihren zeitgenössischen Gebrauchsweisen und Bedeutungen. In diesem Proseminar mit Praxisbezug beschäftigen wir uns mit Amateurfilmen als Medien des Geschichtsjournalismus und analysieren aktuelle Positiv- und Negativbeispiele zu ihrer Verwendung. Diese dienen den Studierenden als Vorlage und Inspiration für einen eigenen Kurzfilm über historische Amateuraufnahmen, der im Zuge des Proseminars realisiert werden soll. Die Lehrveranstaltung vermittelt Kenntnisse zur Recherche und zum Umgang mit Archivmaterial, aber auch zu Filmschnitt und Bild- bzw. Tonmontage.
[Si] Die Gesellschaft des Internets. Soziale Medien von 1979 bis heute
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 16:00 - 18:00 Uhr | Phil. I, C 214 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 214 | ||
Seit den späten 1970er Jahren entstanden digitale Räume, die als „soziale Medien“ gelten können und später dann auch als solche bezeichnet wurden: von den ersten Bulletin Board Systems (BBS) und Newsgroups über frühe Plattformen wie Friendster, dann MySpace und StudiVZ bis hin zu Facebook, Instagram oder TikTok.
Diese Medien prägten nicht nur Kommunikationsformen, sondern auch soziale Beziehungen, politische Diskurse und kulturelle Ausdrucksweisen. Anfangs galten sie als utopisches Versprechen: freie Teilhabe, globale Vernetzung, demokratische Öffentlichkeit. Heute jedoch dominieren die dystopischen Diagnosen: Die Nutzer:innen stecken in Filterblasen, die Algorithmen schüren Wut und Erregung, die Kommunikationsmacht liegt in Händen weniger Konzerne, die Kontrolle zu ihrem Geschäft gemacht haben. Zwischen den utopischen Potentialen und dieser Ernüchterung entfaltet sich eine Geschichte, die bis in unsere Gegenwart reicht.
Das Seminar untersucht die Entwicklung und gesellschaftliche Bedeutung von sozialen Medien von 1979 bis heute. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Plattformen soziale Praktiken und Vergesellschaftung prägten und wie sich gesellschaftliche Hoffnungen, Konflikte und Ängste in ihnen widerspiegelten. Die Veranstaltung kombiniert die Lektüre mit der Analyse konkreter Plattformen und Diskurse.
Literatur zur Einführung:
José van Dijck: The Culture of Connectivity. A Critical History of Social Media. Oxford 2013.
Felix Stalder: Kultur der Digitalität. Berlin 2016.
[P Si] Einführungskurs: Medien und ihr Publikum
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. I, C 030 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 030 | ||
Das Proseminar richtet sich wie die Vorlesung an die Studienanfänger/innen der Fachjournalistik Geschichte und bietet eine Einführung in das Studienfach. Wir werden uns hier mit der Geschichte und Gegenwart der Printmedien, des Fotojournalismus, des Kinos, Radios, Fernsehens und Internets sowie deren Nutzung und Aneignung durch das Publikum auseinandersetzen. Außer mit wissenschaftlichen Texten arbeiten wir mit Quellen, also mit konkreten Reportagen, Pressefotos, Filmen, Radio- und Fernsehsendungen sowie Präsentationen im Netz.
Ergänzend wird ein Tutorium angeboten, dessen Besuch wir nachdrücklich empfehlen. Unter der Anleitung von fortgeschrittenen Studierenden können Sie hier in Kleingruppen Fragen aus Vorlesung und Proseminar weiter vertiefen, Sie analysieren gemeinsam aktuelle Medienprodukte, üben sich selbst in journalistischen Darstellungsformen und werden in Techniken wissenschaftlichen Arbeitens eingewiesen. Die Termine der zur Auswahl stehenden Tutorien werden in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.
[Si] Geschichte der Werbung
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2025 | ||
| wöchentlich Do. 12:00 - 14:00 Uhr | Phil. I, C 214 | |
| nächster Termin: 12.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 214 | ||
Werbung und private Kleinanzeigen hatten einen erheblichen Anteil an der Entstehung von Massenmedien. Zeitungs- und Zeitschriftenverlage finanzieren ihre Medienprodukte oft zu einem größeren Teil aus Werbeanzeigen als über den Verkauf. Zugleich sind Anzeigen vielsagende Quellen ihrer Zeit. Werbung für Konsumartikel kam auf, als ein wachsender Anteil der Bevölkerung über ein Einkommen verfügte, das es erlaubte, auch nicht lebensnotwendige Dinge zu kaufen. Um zu solchen Käufen zu verlocken, verspricht die Werbung vieles, was in der anvisierten Zielgruppe zur gegebenen Zeit mutmaßlich erstrebenswert erscheint. Rückblickend können wir solchen Quellen also einiges über Wunsch- und Wertvorstellungen entnehmen. Gleichzeitig scheint in Bildern und Texten von Werbeanzeigen auf, was vielen Zeitgenoss:innen selbstverständlich vorkam: Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit etwa, von fernen Ländern, ethnischen und sozialen Differenzen, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir werden in diesem Seminar Werbung aus verschiedenen Epochen und für unterschiedlichste Produkte studieren, überlegen auf welche Fragen sie uns Antworten geben können und uns dafür Anregungen aus diversen Subdisziplinen wie der Medien-, Mentalitäts-, Konsum- und Wirtschaftsgeschichte holen.
[Vl] Medien und ihr Publikum
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2025 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr | Phil. I, A 3 (Hörsaal) | |
| nächster Termin: 09.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, A 3 (Hörsaal) | ||
Diese Vorlesung richtet sich an die Erstsemester im BA- und MA-Studienfach Fachjournalistik Geschichte. Sie führt ein in die Geschichte der verschiedenen Massenmedien – Presse, Film, Radio, Fernsehen und Internet – und verfolgt deren Entwicklung vom Beginn der Neuzeit bis in die Gegenwart. Anhand aussagekräftiger historischer Fallstudien schauen wir uns gemeinsam an, wie und mit welchem Selbstverständnis Journalist:innen für die verschiedenen Medien gearbeitet haben, wie das Publikum diese genutzt und ihre Botschaften aufgenommen hat, welche medialen Eigenlogiken sich im Vergleich feststellen lassen und welcher Kritik sowohl die Medien als auch ihr Publikum immer wieder ausgesetzt waren und sind.
Die Vorlesung ist abgestimmt auf das Proseminar gleichen Titels und das Tutorium, dessen Besuch wir nachdrücklich empfehlen. Unter der Anleitung von fortgeschrittenen Studierenden können Sie hier in Kleingruppen Aspekte aus Vorlesung und Proseminar weiter vertiefen, Sie analysieren gemeinsam aktuelle Medienprodukte und üben sich in den Grundtechniken wissenschaftlichen Arbeitens. Die Termine dafür werden in der ersten Woche verabredet.
[Si] Medientheorien. Geschichte und Anwendung
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. I, E 005 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, E 005 | ||
Medien sind nicht nur technische Apparate oder Kommunikationsmittel, sondern prägen als solche Wahrnehmung, Kultur und Gesellschaft. Seit dem frühen 20. Jahrhundert haben Medientheorien versucht, diese komplexen Wechselwirkungen zu verstehen und zu beschreiben. Von ersten Überlegungen zu Massenmedien und Öffentlichkeit über die Kulturkritik der Frankfurter Schule bis hin zu Theorien der „Aufschreibesysteme“ oder „Medienarchäologie“ reicht das Spektrum, das bis heute unser Verständnis „der Medien“ bestimmt.
Das Seminar ist als Lektüreseminar konzipiert. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Lektüre und Diskussion zentraler medientheoretischer Texte (z.B. von Walter Benjamin, Marshall McLuhan, Niklas Luhmann, Friedrich Kittler oder José van Dijck). Ziel ist es, einerseits die historischen Linien und Denkansätze in der Medienforschung nachzuvollziehen und andererseits ihre Relevanz für die historische Forschung und aktuelle Fragestellungen zu prüfen. Neben der Erarbeitung theoretischer Grundlagen wird auch die Anwendung erprobt: Studierende setzen sich mit der Frage auseinander, wie sich medientheoretische Konzepte auf konkrete Phänomene – von der Massenpresse über Film und Fernsehen bis hin zu TikTok – übertragen lassen. Damit vermittelt das Seminar nicht nur einen Überblick über die Geschichte der Medientheorien, sondern auch Werkzeuge zur eigenständigen Analyse.
Literatur zur Einführung:
Günter Helmes/Werner Köster (Hrsg.): Texte zur Medientheorie. Ditzingen 2002.
Tilman Baumgärtel (Hrsg.): Texte zur Theorie des Internets. Ditzingen 2017.
[P Si] Verführung und Gewalt? Populäre Kultur im Nationalsozialismus
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2025 | ||
| wöchentlich Mo. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. I, C 214 | |
| nächster Termin: 09.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 214 | ||
Die nationalsozialistische Herrschaft wurde lange Zeit als ein System der „Verführung und Gewalt“ beschrieben, und in der breiteren Öffentlichkeit hat diese Interpretation durchweg Konjunktur. Doch lässt sich diese Deutung auf die Populärkultur im „Dritten Reich“ übertragen? Waren Theater, Presse und Buch, Film, Musik, Sport oder Massenfeste in erster Linie Instrumente der Indoktrination und Manipulation? Boten sie auch Räume von Normalität, Unterhaltung und eigensinnigem Vergnügen, die den Bedürfnisse einer modernen Massengesellschaft entsprachen?
Das Seminar nimmt die ambivalente Rolle populärer Kultur im Nationalsozialismus in den Blick. Anhand von Fallbeispielen wie der NS-Filmindustrie, dem lebhaften Buchmarkt, den Zeitschriften und Groschenheften und den Veranstaltungen der Massenorganisation „Kraft durch Freude“ wird diskutiert, wie eng Unterhaltung und Vergnügen, Propaganda und Gewalt miteinander verflochten waren.
Im Mittelpunkt steht dabei die Stadt Gießen als Beispiel einer „normalen“ deutschen Mittelstadt. Aufbauend auf Michael Maass’ Studie zu Nürnberg (Freizeitgestaltung und kulturelles Leben in Nürnberg 1930–1945, Nürnberg 1994) soll untersucht werden, welche Formen populärer Kultur in Gießen existierten, wieweit sie von der NS-Herrschaft gesteuert wurden und welche Bedeutung sie für das Alltagsleben der Bevölkerung hatten.
Literatur zur Einführung:
Moritz Föllmer: Kultur im Dritten Reich. Die Entfaltung der Volksgemeinschaft. München 2021.
Hannah Ahlheim: Der Nationalsozialismus 1933-1939. Paderborn 2025.
[Si] Wozu Geschichte? Historisches Denken, historisches Erzählen und Geschichtskultur
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2025 | ||
| wöchentlich Do. 16:00 - 18:00 Uhr | Phil. I, C 214 | |
| nächster Termin: 12.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 214 | ||
Ausgehend von Ihren Erfahrungen mit dem Verfassen geschichtswissenschaftlicher Hausarbeiten und womöglich ersten eigenen geschichtsjournalistischen Versuchen wollen wir in diesem Einstiegsseminar in den Master Fachjournalistik Geschichte (oder Geschichte) grundlegende Fragen hinsichtlich der Besonderheit, der Relevanz und des Nutzens historischen Wissens stellen. Wir werden untersuchen, wie Historiker:innen ihre Themen finden, wie sie durch die Wahl der Perspektive, der Methode und der bearbeiteten Quellen die Ergebnisse ihrer Forschung beeinflussen, wie sie Geschichte schreiben und dabei Erkenntnisse vermitteln. Und wir wollen genauer hinschauen, wie populäre Geschichtsvermittlung funktioniert, was hier die Themenwahl und Darstellungsweise beeinflusst und welche Geschichtsbilder auf diese Weise entstehen. Wann und auf welche Weise dient Geschichte – gerade in ihrer populären Form – der politischen Legitimation, der Identitätsstiftung, der Gesellschaftskritik, der Unterhaltung? Anhand welcher Kriterien können wir historische Darstellungen beurteilen? Welche Rolle spielen dabei z.B. Wahrheit, Multiperspektivität, Erklärungskraft und die Qualität der Darstellung? Das Seminar lädt ein zur Reflexion historischer Praxis, wie sie Ihnen alltäglich in Texten, Bildern, Filmen etc. begegnet, wie Sie sie aber auch selbst bereits ausüben oder in Zukunft ausüben werden.
Geschichte ⇑
[H Si] Das deutsche Kaiserreich und der Kolonialismus
Deutschland war mal eine Kolonialmacht. Im westeuropäischen Vergleich spät und kurz übten Deutsche Herrschaft in Afrika, China und Ozeanien aus. Beschlossen wurde das in Berlin 1884/85 und beendet wurde es in Versailles 1919. Wie und warum? Was passierte in den knapp 35 Jahren und welche Nachwirkungen hat(te) die Zeit? Diesen Fragen wollen wir im Seminar anhand von Quellen und unter Einbeziehung der ständig wachsenden Forschungsliteratur nachgehen. Das Hauptsemsinar richtet sich vor allem an Lehramtsstudierende, die im WS ihr Praxissemester absolvieren. Deshalb beginnen wir mit einer Einführung Anfang des Semesters und steigen dann in der Mitte des Semesters richtig ein. Aber auch alle anderen Interessierten sind selbstverständlich herzlich willkommen.
Literatur zur Einführung:
Winfried Speitkamp, Deutsche Kolonialgeschichte, Ditzingen 2021
Marianne Bechhaus-Gerst, Joachim Zeller (Hg.), Deutschland postkolonial? Die Gegenwart der imperialen Vergangenheit, Berlin 2021
[Ü] Demokratie made in Gießen: Wilhelm Liebknecht
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2025 | ||
| wöchentlich Do. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. I, C 113 | |
| nächster Termin: 12.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 113 | ||
In diesem Jahr ist er 125 Jahre tot, im nächsten Jahr jährt sich seine Geburt zum 200. Mal. Wilhelm Liebknecht (1826-1900), Begründer der Sozialdemokratie, Weggefährte von Karl Marx und Friedrich Engels, Vater von Karl Liebknecht und Ehemann (nacheinander) von Ernestine und Natalie Liebknecht ist in Gießen geboren und hat die Stadt im Vormärz als Student geprägt.
Jubiläen sind ein Anlass, neu auf Personen und Ereignisse zu schauen. Das wollen wir in der Übung tun. Liebknecht war Publizist und hat mit Formulierungen wie "Wissen ist Macht - Macht ist Wissen" Generationen geprägt. Was sagt er uns heute noch? Wie aktuell sind seine Gedanken zu Bildung, Demokratie, Krieg und Frieden? Die Stadt Gießen wird ihn groß feiern - umso wichtiger, sich mit ihm zu befassen.
Biografie zur Einführung
Wolfgang Schröder, Wilhelm Liebknecht. Soldat der Revolution, Parteiführer, Parlamentarier, Berlin 2013
[Ü] Gender and Development in 20th-century Southeastern Europe
| regelmäßiger Termin ab 15.10.2025 | ||
| zwei-wöchentlich Mi. 09:00 - 12:00 Uhr | Phil. I, B 033 | |
| nächster Termin: | ||
What does the situation of women reveal about the development of a society? This interdisciplinary course explores this question through the lens of Southeastern Europe in the 20th century. Building on existing narratives of “backwardness” and development initiatives in the region, we focus specifically on the perspectives of women—voices that have often been omitted from historical accounts.
Using a variety of sources such as oral history interviews, autobiographies, letters, poetry, and photographs—some of them in the original languages—we examine the ambivalent lived experiences of women in different social contexts. In doing so, we critically engage with the complex concept of “development”—one of the most frequently used terms in politics and society—by highlighting gender as a largely overlooked dimension.
Digital and AI-based tools (Transkribus, DeepL, ChatGPT) will also be employed, allowing us to critically reflect on their potentials and limitations in historical research.
The course introduces students to working with non-traditional sources, raises awareness of gender-related questions in development debates, and offers an engaging entry point into the history of Southeast Europe. It is designed for anyone interested in critical historiography, interdisciplinary research, and digital methods.
Was sagt die Situation von Frauen über die Entwicklung einer Gesellschaft aus? In diesem interdisziplinären Kurs gehen wir dieser Frage am Beispiel Südosteuropas im 20. Jahrhundert nach. Ausgehend von bestehenden Narrativen über „Rückständigkeit“ und Entwicklungsinitiativen in der Region gehen wir gezielt auf die Perspektive von Frauen ein, deren Stimmen in historischen Darstellungen oft ausgelassen wurden.
Anhand unterschiedlicher Quellen wie oral history-Interviews, Autobiografien, Briefen, Gedichten oder Fotografien – teilweise in Originalsprachen – beleuchten wir ambivalente Lebensrealitäten von Frauen in verschiedenen sozialen Kontexten. Dabei hinterfragen wir den vielschichtigen Begriff von „Entwicklung“ – einen der meistverwendeten Begriffe in Politik und Gesellschaft – mit einem Fokus auf Geschlecht als bislang wenig beachteter Dimension. Zum Einsatz kommen auch digitale und KI-gestützte Werkzeuge (Transkribus, DeepL, ChatGPT), deren Potenziale und Grenzen wir im historischen Arbeiten kritisch reflektieren.
Der Kurs vermittelt Grundlagen im Umgang mit nicht-traditionellen Quellen, sensibilisiert für Geschlechterfragen in Entwicklungsdebatten und bietet einen spannenden Einstieg in die Geschichte Südosteuropas. Er richtet sich an alle, die an kritischer Geschichtsschreibung, interdisziplinärer Forschung und digitalen Methoden interessiert sind.
[P Si] Geschlecht und Geschichte
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. I, C 113 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 113 | ||
Momentan inszenieren sich sogenannte tradwives auf Instagram, die strahlend Kekse backen oder Kinderkleider nähen und dem von der Arbeit müden Ehegatten ein Abendessen zaubern. Was hat es mit diesem Trend auf sich? Worauf bezieht er sich?
Geschlechterrollen unterliegen einem historischen Wandel, der sich beobachten und analysieren lässt. Wir erfahren durch die Analyse etwas über Gesellschaften und ihre Normen und Praktiken. Im Seminar befassen wir uns mit US-amerikanischer und europäischer Geschlechtergeschichte als Teil einer Geschichte sozialer Ungleichheit. Gleichzeitig ist das Proseminar eine Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten mit einem hohen propädeutischen Anteil.
Literaturhinweis:
Claudia Opitz-Belakhal, Geschlechtergeschichte, 2. Aufl., Frankfurt/M. 2018
[Ü] Quellen zu Frauen im Mittelalter (AfK-Nr.: 11)
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 16:00 - 18:00 Uhr | Phil. I, C 011 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, C 011 | ||
Die Vorstellungen von weiblichem Leben im Mittelalter sind in der Regel durch eine festes Bild geprägt: Frauen würden entweder eine, wie auch immer geartete, eheliche Verbindung eingehen - oder im Kloster leben. Weibliches Handeln sei stark limitiert und de facto von konsequenter Unterdrückung geprägt. Dass weibliches Leben und Handeln auch im Mittelalter deutlich fluider und vielfältiger gestaltet sein konnte, soll im Rahmen der Übung anhand ausgewählter Quellen herausgearbeitet werden. Neben einer Einführung in die unterschiedlichen Quellenformen des Mittelalters, wird auch in die Historischen Hilfswissenschaften eingeführt und über grundlegende Praktiken des geschichtswissenschaftlichen Arbeitens gesprochen. Da auch mit originalsprachlichen Dokumenten gearbeitet wird, sind Lateinkenntnisse erforderlich.
Islamische Theologie ⇑
Katholische Theologie ⇑
[Si] Gender, Ehe und Abendmahl: Die Probleme einer christlichen Gemeinde und Paulus‘ Orientierung an der Tora (Biblische Theologie)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2025 | ||
| wöchentlich Mo. 10:00 - 12:00 Uhr | Phil. II, H 209 | |
| nächster Termin: 09.02.2026 Uhr, Raum: Phil. II, H 209 | ||
Kein zweites Schreiben im Neuen Testament erlaubt uns einen so tiefen Einblick in die konkreten Probleme einer frühchristlichen Gemeinde wie der Erste Korintherbrief. Viele der strittigen Fragen, mit denen sich die korinthische Gemeinde auseinandersetzte, haben nichts an Aktualität verloren, gleich ob es sich um die Ehepastoral, den für pagane Christen noch neuen Monotheismus, die geordnete Herrenmahlfeier oder Vorstellungen von der Auferstehung handelt. In allen Fragen rekurrierte Paulus auf die Schriften Israels. Das Seminar will diesen Rekursen nachgehen, die Probleme der korinthischen Gemeinde in ihrem historischen Umfeld verankern und nach ihrer Relevanz für die heutige Gemeindepraxis fragen.
Literatur zum Einstieg: H.-J. Klauck, 1. Korintherbrief (NEB.NT 7), Würzburg 52009 (1984); W. Schrage, Der erste Brief an die Korinther. 4 Vol. (EKK 7), Zürich; Neukirchen-Vluyn 1991–2001.
[Vl] Religion(en) in Kultur und Gesellschaft. Einführung in die Religionswissenschaft
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. II, H 205 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. II, H 205 | ||
Das konfliktreiche, aber auch das bereichernde Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen und Religionen ist in Zeiten der Globalisierung zum Alltag geworden. Um die erlebte Vielfalt des religiösen Lebens heute verstehen und konstruktiv gestalten zu können, ist es notwendig, sich mit dem Phänomen Religion und den großen religiösen Traditionen der Menschheitsgeschichte auseinanderzusetzen. Die Vorlesung gibt eine Einführung in die heutige Religionswissenschaft und eine Übersicht über zentrale religiöse Großtraditionen, ihre Inhalte, Rituale und Ethiken. Dieses Wissen ist auch von großer aktueller Relevanz für die Lehramtsstudiengänge in Religion und Ethik.
Literaturhinweise zum Einstieg (weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben):
M. Baumann/A. Kenneth-Nagel, Religion und Migration. Baden Baden 2023 - Klaus Hock, Einführung in die Religionswissenschaft, 5. Aufl., Darmstadt 2014 - H.G. Kippenberg/K. v. Stuckrad, Einführung in die Religionswissenschaft. Gegenstände und Begriffe, München 2003 - K. Lehmann (Hg.), Weltreligion. Verstehen-Verständigung-Verantwortung, Berlin 2009; S. Schlager, Die Weltreligionen. Ein Crash-Kurs, Kevelaer 2012.
Kunstgeschichte ⇑
Philosophie ⇑
Turkologie ⇑
Sprache, Literatur, Kultur (Fachbereich 05)
[Si] Ehebrecher, Hochstapler, Raubritter – zweifelhafte Helden im Mittelalter
| regelmäßiger Termin ab 22.10.2025 | ||
| wöchentlich Mi. 16:00 - 18:00 Uhr | Phil. I, B 128 (Karl-Wolfskehl-Saal) | |
| nächster Termin: 11.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, B 128 (Karl-Wolfskehl-Saal) | ||
Texte des Mittelalters kennen nicht nur tugendhafte Ritter, die sowohl dem höfischen Ehrenkodex wie auch dem religiösen Guten zustreben. Auch Betrüger, die den Leuten mit unterschiedlichen Lügengeschichten ihr Geld abnehmen, Raubritter, die mordend durch die Lande ziehen oder Ehebrecher, denen die sexuelle Erfüllung wichtiger als jede moralische Norm ist, können im Fokus mittelalterlicher Erzählungen stehen. Doch was für ein Heldenbild wird dadurch vermittelt und wieso erzählt man davon? Diese und weitere Fragen die narratologische Gestaltung betreffend wollen wir anhand von Strickers „Pfaffe Amis“, Werners der Gartenaere „Meier Helmrecht“ und dem „Mauricius von Craûn“ im Seminar besprechen.
[Si] Lyrik des Exils von Ovid bis Kaléko
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 16:00 - 18:00 Uhr | Phil. I, B 106 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, B 106 | ||
Erfahrungen von Flucht und Vertreibung und Leben im Exil haben sich auch in der Lyrik niedergeschlagen, wo immer Autor/innen gezwungen waren und sind, ihre Heimat zu verlassen. Das Seminar gibt Gelegenheit, einige bedeutende Werke und Autor/innen der Exillyrik kennenzulernen: angefangen vom römischen Dichter Ovid, den Kaiser Augustus ans Schwarze Meer verbannte, über Heinrich Heine im Pariser Exil bis zu Bertolt Brecht, Mascha Kaléko, Else Lasker-Schüler u.a., die vor dem nationalsozialistischen Regime fliehen mussten.
Schwerpunkte im Seminarprogramm werden nach den Interessen der Teilnehmenden gesetzt.
Zur Einführung: Bettina Bannasch und Gerhild Rochus (Hrsg.), Handbuch der deutschsprachigen Exilliteratur. Von Heinrich Heine bis Herta Müller, Berlin und Boston, Mass. 2013 (Zugriff: https://justfind.hds.hebis.de/Record/HEB322881196)
Empfehlenswertes Web-Portal: https://we-refugees-archive.org/
[Ü] Miloš Forman - From Socialist experience to winning the Oscar twice
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 14:00 - 16:00 Uhr | Phil. I, E 004 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, E 004 | ||
The class is open to any student of JLU but since it is part of the English track of JLU’s MA program Interdisciplinary studies on Eastern Europe it will be held in English.
In the class we will be watching and discussing the movies of Czechoamerican film director Miloš Forman.
We will also read up on the analysis of movies and apply that new knowledge to our discussions of the films. The text book used for the introduction to film analysis will be Film Art. An Introduction (10th edition) by David Bordwell and Kristin Thompson. The university library has several copies available (https://hds.hebis.de/ubgi/Record/HEB335088945).
Here a list of some of the movies that we will be analyzing. The final choice of the movies will depend on the specific country interest of the participants:
In the first session I would like to discuss how films as an art form differ from other art forms as literature and theatre. What is the specific difference between thise art forms.
In the first session we will also discuss if we are going to watch the movies together or individually at home. The amount of awarded credits points allows us to watch and discuss about 8 or 9 movies. For each movie a list of questions should be prepared for the class. The questions function as a starting point for our discussions.
[Si] Poststrukturalismus, Postkolonialismus, Postfeminismus
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr | Phil. I, D 209 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, D 209 | ||
Dieses Seminar führt Masterstudierende in die für die aktuelle Slavistik grundlegende Literatur- und Kulturtheorie des Poststrukturalismus ein, der sich von Foucaults Diskursanalyse und Derridas Dekonstruktion herleitet und Anwendungsfelder in postfeministischen Gender Studies und postkolonialer Theoriebildung gefunden hat. Der Fokus liegt auf dem Verstehen weniger, aber durchaus nicht einfacher Texte, die nach individueller Vorlektüre in der Übung gemeinsam interpretiert und diskutiert werden. Am Schluss der drei Blöcke – Poststrukturalismus, Postfeminismus und Postkolonialismus – stehen jeweils slavistische Fortschreibungen der vorzugsweise französischen und anglo-amerikanischen Theorie-Anregungen.
Weitere Teilnehmende sind willkommen; zur Anmeldung bitte E-Mail an dirk.uffelmann@slavistik.uni-giessen.de
[Si] Zwischen Science und Fiction: Konzepte der Science-Fiction-Literatur.
| regelmäßiger Termin ab 14.10.2025 | ||
| wöchentlich Di. 12:00 - 14:00 Uhr | Phil. I, B 210 | |
| nächster Termin: 10.02.2026 Uhr, Raum: Phil. I, B 210 | ||
In diesem Seminar wollen wir uns mit Konzepten und exemplarischen Beispielen der Science-Fiction-Literatur beschäftigen, wobei drei Fragen im Zentrum stehen sollen. Erstens: Welche Form von Science wird in Science-Fiction-Literatur imaginiert – welches Wissenschaftsverständnis wird damit impliziert? Zweitens: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Techniken und Technologien – welches Technikverständnis wird damit impliziert? Drittens: Wie wird das Verhältnis zwischen Mensch und Technik (respektive Mensch und Maschine) gedacht – Welches Menschenverständnis wird hier impliziert?
Mögliche Primärtexte (die Liste ist durchaus noch veränderbar) für dieses Seminar können sein: E.T.A. Hoffmanns "Der Sandmann", Mary Shelleys "Frankenstein", H.G. Wells, "Die Zeitmaschine", Kurd Laßwitz "Der Traumfabrikant", Aldous Huxleys "Brave New World" (in deutscher Übersetzung: "Welt – Wohin. Ein Roman der Zukunft"), Isaac Asimov, "Ich, der Robot", Robert A. Heinlein, "Sternenkrieger", William Gibson, "Neuromancer", Stanislaw Lem, "Der futurologische Kongress", Philip K. Dick, "Total Recall" und "Bladerunner".
Teilnahmevoraussetzung: Alle Teilnehmenden müssen regelmäßig teilnehmen und einen Text vorstellen (Teamarbeit ist möglich)
Hausarbeiten haben einen Umfang von 20-25 Seiten (1,5 Zeilen, 12 Punkt Schriftgröße) und sind bis zum 15.3. 2026 abzugeben.
Psychologie und Sportwissenschaft (Fachbereich 06)
Biologie und Chemie (Fachbereich 08)
[Si] M3 Biologiedidaktische Vertiefung - Übung - "Diversität im Klassenzimmer – Gendersensibler Biologieunterricht" - Gruppe 3 - Kurschildgen (BioD-L2L3L5-3)
Melden Sie sich deshalb für eine Gruppe der 3 angebotenen Übungen an, die jeweils in Präsenz zu den angegebenen Zeiten stattfinden.
Zusätzlich müssen Sie sich in Stud.IP separat für die Veranstaltung M3 Biologiedidaktische Vertiefung - Basismodul anmelden, das als Ergänzung zu den Übungen asynchron online angeboten wird. Bei Fragen zu diesem Modul melden Sie sich bitte per Mail bei Frau Dr. Elvira Schmidt (elvira.schmidt@didaktik.bio.uni-giessen.de).
Zu den Seminaren (Präsenz, Zeiten s. oben) können Sie sich selbstständig ab dem 01.10.2025, 15 Uhr, bis zum 01.11.2025 in Stud.IP anmelden.
Die Anmeldung erfolgt nach dem „Windhundverfahren“.
Zur Anmeldung gehen Sie auf Teilnehmende und dann links auf Gruppen. Dort sehen Sie alle Übungen mit den jeweiligen Zeiten im Überblick.
In diesem Seminar „Diversität im Klassenzimmer – Gendersensibler Biologieunterricht“ werden Inhalte einer ganzheitlichen, sprach- und kultursensibler Sexualbildung thematisiert. Folgende Themen werden u.a. im Rahmen des Seminars behandelt: Rolle des Biologieunterrichts zur Sexuellen Bildung/ Vermittlung von Genderkompetenzen, Curriculare Grundlagen, Sex und Gender, sexuelle Vielfalt, Geschlechtsausdruck und -identität. Ziel des Seminars ist es, die Studierenden mit den Themen vertraut zu machen, ihnen Literatur, Materialien und Beratungsstellen an die Hand zu geben und anzuregen, die eigene Haltung und Verantwortung zu den Themen zu reflektieren. Dabei soll das Seminar inhaltlich über die Planung einer Unterrichtseinheit hinausgehen, und sich forschungsbasiert und reflektiert mit Themen der Geschlechterforschung im Kontext der Sexualbildung befassen. Das Seminar soll Studierenden den Raum geben, Themen, die sie im Bereich der Sexualbildung interessieren, mit einbringen zu dürfen.
| regelmäßiger Termin ab 16.10.2025 | ||
| wöchentlich Do. 10:15 - 11:45 Uhr | Phil. II C, 003 (Medienlabor) (M3 Biologiedidaktische Vertiefung - Diversität im Klassenzimmer - Gendersensibler BU - Übung - Gruppe 3 ) | |
| nächster Termin: 12.02.2026 Uhr, Raum: Phil. II C, 003 (Medienlabor) | ||
Das Modul 3 - Biodidaktische Vertiefung umfasst 4 SWS und besteht aus 2 Veranstaltungen mit je 2 SWS.
Melden Sie sich deshalb für eine Gruppe der 3 angebotenen Übungen an, die jeweils in Präsenz zu den angegebenen Zeiten stattfinden.
Zusätzlich müssen Sie sich in Stud.IP separat für die Veranstaltung M3 Biologiedidaktische Vertiefung - Basismodul anmelden, das als Ergänzung zu den Übungen asynchron online angeboten wird. Bei Fragen zu diesem Modul melden Sie sich bitte per Mail bei Frau Dr. Elvira Schmidt (elvira.schmidt@didaktik.bio.uni-giessen.de).
Zu den Seminaren (Präsenz, Zeiten s. oben) können Sie sich selbstständig ab dem 01.10.2025, 15 Uhr, bis zum 01.11.2025 in Stud.IP anmelden.
Die Anmeldung erfolgt nach dem „Windhundverfahren“.
Zur Anmeldung gehen Sie auf Teilnehmende und dann links auf Gruppen. Dort sehen Sie alle Übungen mit den jeweiligen Zeiten im Überblick.
In diesem Seminar „Diversität im Klassenzimmer – Gendersensibler Biologieunterricht“ werden Inhalte einer ganzheitlichen, sprach- und kultursensibler Sexualbildung thematisiert. Folgende Themen werden u.a. im Rahmen des Seminars behandelt: Rolle des Biologieunterrichts zur Sexuellen Bildung/ Vermittlung von Genderkompetenzen, Curriculare Grundlagen, Sex und Gender, sexuelle Vielfalt, Geschlechtsausdruck und -identität. Ziel des Seminars ist es, die Studierenden mit den Themen vertraut zu machen, ihnen Literatur, Materialien und Beratungsstellen an die Hand zu geben und anzuregen, die eigene Haltung und Verantwortung zu den Themen zu reflektieren. Dabei soll das Seminar inhaltlich über die Planung einer Unterrichtseinheit hinausgehen, und sich forschungsbasiert und reflektiert mit Themen der Geschlechterforschung im Kontext der Sexualbildung befassen. Das Seminar soll Studierenden den Raum geben, Themen, die sie im Bereich der Sexualbildung interessieren, mit einbringen zu dürfen.
Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement (Fachbereich 09)
[M] Genderaspekte in der Entwicklungszusammenarbeit (MP-131)
Medizin (Fachbereich 11)
[Si] Geschlechtergerechte Sprache in Studium und Beruf
In dieser Veranstaltung setzen wir uns aus verschiedenen Perspektiven mit geschlechtergerechter Sprache auseinander.
Hierfür wird in einem allgemeinen Teil zunächst ein kurzer Überblick über die Entstehung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs bzw. der Forderung danach im Deutschen gegeben. Gesetzliche Diskriminierungsverbote, Regulierung durch den Rat für deutsche Rechtschreibung, Bedingungen des Sprachsystems und emanzipatorische Anliegen werden zueinander in Beziehung gesetzt.
ln einem speziellen Teil kann die besondere Notwendigkeit geschlechtersensibler Sprache an Praxisbeispielen wie z.B. im (hochschulischen) Medizinbereich diskutiert werden. Dabei geht es ebenso um einen diskriminierungsfreien und respektvollen Umgang mit Kolleg*innen und Patient*innen wie um die (mentale) Öffnung der Perspektive in Forschung, Diagnose und Therapie für alle Geschlechter.
Ziel ist es, ein Verständnis für die Bedeutung von geschlechtergerechter Sprache für ein erfolgreiches Studium und einen erfolgreichen Berufsverlauf zu entwickeln.
Referentin:
Frau Dr. Bärbel Miemietz, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover und Sprachwissenschaftlerin
[Kurs] Interdisziplinäre Schädelbasischirurgie
ulricke.bockmuehl@klinikum-kassel.de oder
wolfgang.deinsberger@klinikum-kassel.de
[Wshop] Positionierung in Machtarenen - Die Regeln verstehen – schlagfertig agieren
Kommunikation ist eine entscheidende Komponente im beruflichen Kontext. Die Fähigkeit, sich zu behaupten, sicher und souverän aufzutreten und schlagfertig zu agieren, stellt eine Herausforderung dar - sei es in Einzelgesprächen, in Gremien oder in Bewerbungsgesprächen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Frauen und Männern liegt in der Selbstverständlichkeit, mit der sie sich präsentieren und ihre Standpunkte und Stärken vertreten. Frauen haben die Möglichkeit zu lernen, sich auch in männerdominierten Bereichen durchzusetzen und ihre eigenen Interessen selbstbewusst zu vertreten. In diesem Seminar werden Kommunikationsregeln vermittelt und der zielorientierte Umgang damit trainiert. Die Teilnehmerinnen werden in ihrer authentischen Präsenz gestärkt, um sich im Gespräch durchzusetzen, Respekt einzufordern und einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Zur Teilnahme sind Personen aller Geschlechter eingeladen. Dadurch wird ein Perspektivenwechsel ermöglicht, der die Geschlechter für unterschiedliche Kommunikationsmuster sensibilisiert.
Inhalt des Workshops:
• Genderspezifische Kommunikationsmuster – wirkungsvoller Umgang
• Authentischen Redestilstärken und Souveränität erhöhen
• Durchsetzen – positionieren – Respekt einfordern
• Atem, Körper und Stimme als unterstützendes Element
• Wahrnehmungsschulung, Zeichen setzen – Zeichen deuten
• Schlagfertig agieren – nachhaltig Eindruck hinterlassen
[Wshop] Sexualisierte Gewalt im Arbeitskontext
Immer wieder sind Student_innen und Mitarbeiter_innen mit dem Thema der sexuellen Belästigung/sexualisierten Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert.
Damit Sie auf dem Weg die Belästigung zu beenden Unterstützung erfahren und Handlungssicherheit gewinnen, sind die Kenntnis von Formen sexueller Belästigung und möglichen Vorgehensweisen wichtiges Handwerkszeug.
Im Rahmen der Schulung werden folgende Inhalte vorgestellt und bearbeitet werden:
- kurze allgemeine Einführung- was ist unter sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu verstehen? Wer ist betroffen?
- Rechtliche Grundlagen
- Welche Wege können Betroffene Gehen?
Referentin:
Doris Kroll
[Si] Vertiefungsseminare mit wechselnden Themen im SPC Global Health (Modul 7-9 im SPC Global Health)
Anmeldung /Infos unter: http://www.uni-giessen.de/fbz/fb11/studium/medizin/klinik/spc/spc-global
Zentrum für fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen
[Si] Geschlechtergerechte Sprache in Studium und Beruf
In dieser Veranstaltung setzen wir uns aus verschiedenen Perspektiven mit geschlechtergerechter Sprache auseinander.
Hierfür wird in einem allgemeinen Teil zunächst ein kurzer Überblick über die Entstehung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs bzw. der Forderung danach im Deutschen gegeben. Gesetzliche Diskriminierungsverbote, Regulierung durch den Rat für deutsche Rechtschreibung, Bedingungen des Sprachsystems und emanzipatorische Anliegen werden zueinander in Beziehung gesetzt.
ln einem speziellen Teil kann die besondere Notwendigkeit geschlechtersensibler Sprache an Praxisbeispielen wie z.B. im (hochschulischen) Medizinbereich diskutiert werden. Dabei geht es ebenso um einen diskriminierungsfreien und respektvollen Umgang mit Kolleg*innen und Patient*innen wie um die (mentale) Öffnung der Perspektive in Forschung, Diagnose und Therapie für alle Geschlechter.
Ziel ist es, ein Verständnis für die Bedeutung von geschlechtergerechter Sprache für ein erfolgreiches Studium und einen erfolgreichen Berufsverlauf zu entwickeln.
Referentin:
Frau Dr. Bärbel Miemietz, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover und Sprachwissenschaftlerin
[Wshop] Positionierung in Machtarenen - Die Regeln verstehen – schlagfertig agieren
Kommunikation ist eine entscheidende Komponente im beruflichen Kontext. Die Fähigkeit, sich zu behaupten, sicher und souverän aufzutreten und schlagfertig zu agieren, stellt eine Herausforderung dar - sei es in Einzelgesprächen, in Gremien oder in Bewerbungsgesprächen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Frauen und Männern liegt in der Selbstverständlichkeit, mit der sie sich präsentieren und ihre Standpunkte und Stärken vertreten. Frauen haben die Möglichkeit zu lernen, sich auch in männerdominierten Bereichen durchzusetzen und ihre eigenen Interessen selbstbewusst zu vertreten. In diesem Seminar werden Kommunikationsregeln vermittelt und der zielorientierte Umgang damit trainiert. Die Teilnehmerinnen werden in ihrer authentischen Präsenz gestärkt, um sich im Gespräch durchzusetzen, Respekt einzufordern und einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Zur Teilnahme sind Personen aller Geschlechter eingeladen. Dadurch wird ein Perspektivenwechsel ermöglicht, der die Geschlechter für unterschiedliche Kommunikationsmuster sensibilisiert.
Inhalt des Workshops:
• Genderspezifische Kommunikationsmuster – wirkungsvoller Umgang
• Authentischen Redestilstärken und Souveränität erhöhen
• Durchsetzen – positionieren – Respekt einfordern
• Atem, Körper und Stimme als unterstützendes Element
• Wahrnehmungsschulung, Zeichen setzen – Zeichen deuten
• Schlagfertig agieren – nachhaltig Eindruck hinterlassen
[Wshop] Sexualisierte Gewalt im Arbeitskontext
Immer wieder sind Student_innen und Mitarbeiter_innen mit dem Thema der sexuellen Belästigung/sexualisierten Gewalt am Arbeitsplatz konfrontiert.
Damit Sie auf dem Weg die Belästigung zu beenden Unterstützung erfahren und Handlungssicherheit gewinnen, sind die Kenntnis von Formen sexueller Belästigung und möglichen Vorgehensweisen wichtiges Handwerkszeug.
Im Rahmen der Schulung werden folgende Inhalte vorgestellt und bearbeitet werden:
- kurze allgemeine Einführung- was ist unter sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu verstehen? Wer ist betroffen?
- Rechtliche Grundlagen
- Welche Wege können Betroffene Gehen?
Referentin:
Doris Kroll
Sonstiges
[Si] Geschlechtergerechte Sprache in Studium und Beruf
In dieser Veranstaltung setzen wir uns aus verschiedenen Perspektiven mit geschlechtergerechter Sprache auseinander.
Hierfür wird in einem allgemeinen Teil zunächst ein kurzer Überblick über die Entstehung eines geschlechtergerechten Sprachgebrauchs bzw. der Forderung danach im Deutschen gegeben. Gesetzliche Diskriminierungsverbote, Regulierung durch den Rat für deutsche Rechtschreibung, Bedingungen des Sprachsystems und emanzipatorische Anliegen werden zueinander in Beziehung gesetzt.
ln einem speziellen Teil kann die besondere Notwendigkeit geschlechtersensibler Sprache an Praxisbeispielen wie z.B. im (hochschulischen) Medizinbereich diskutiert werden. Dabei geht es ebenso um einen diskriminierungsfreien und respektvollen Umgang mit Kolleg*innen und Patient*innen wie um die (mentale) Öffnung der Perspektive in Forschung, Diagnose und Therapie für alle Geschlechter.
Ziel ist es, ein Verständnis für die Bedeutung von geschlechtergerechter Sprache für ein erfolgreiches Studium und einen erfolgreichen Berufsverlauf zu entwickeln.
Referentin:
Frau Dr. Bärbel Miemietz, ehemalige Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover und Sprachwissenschaftlerin
[Ü] Leadership (Übung) (02-BWL:BSc-B8-3)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2025 | ||
| wöchentlich Mo. 16:00 - 18:00 Uhr | Licher Straße 68, 23 (HS 4) | |
| nächster Termin: 09.02.2026 Uhr, Raum: Licher Straße 68, 23 (HS 4) | ||
Struktur: Vorlesung + Übung
Turnus: Wintersemester
Credits: 6 CP
Sprache: Englisch
Prüfungsform: Klausur
Inhalte:
• Grundlagen der Personalführung
• Klassische Theorien der Personalführung (z.B. Führungsrollen und Verhalten von Managern, Eigenschaftsansatz, Führungsstiltheorien, situative Theorien)
• Moderne Theorien der Personalführung (z.B. charismatische und transformationale Führung, dyadische Führungstheorien, destruktive Führung, informelle Führung; Führungsethik/ethische Führung)
• Empirische Erkenntnisse der Führungsforschung
Die Veranstaltung findet in Präsenz statt.
[Vl] Leadership (Vorlesung) (02-BWL:BSc-B8-3)
| regelmäßiger Termin ab 13.10.2025 | ||
| wöchentlich Mo. 12:00 - 14:00 Uhr | Licher Straße 68, 23 (HS 4) | |
| nächster Termin: | ||
Struktur: Vorlesung + Übung
Turnus: Wintersemester
Credits: 6 CP
Sprache: Englisch
Prüfungsform: Klausur
Inhalte:
• Grundlagen der Personalführung
• Klassische Theorien der Personalführung (z.B. Führungsrollen und Verhalten von Managern, Eigenschaftsansatz, Führungsstiltheorien, situative Theorien)
• Moderne Theorien der Personalführung (z.B. charismatische und transformationale Führung, dyadische Führungstheorien, destruktive Führung, informelle Führung; Führungsethik/ethische Führung)
• Empirische Erkenntnisse der Führungsforschung
Die Veranstaltung findet in Präsenz statt.



